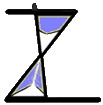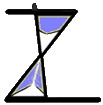31.08.08
Schweigend stehen
sie in unseren Städten und sind dort oft die letzte sichtbare
Erinnerung an die unendlich reichhaltige Natur, in welcher der Mensch
sich ursprünglich entwickelt und über Jahrtausende bewegt
hat.
Sie spenden die Farbe Grün, dessen Unverzichtbarkeit für
eine heiterere Variante des Gemüts so mancher nur noch spürt,
wenn er auf diese einmal länger gänzlich verzichten muss.
Bäume sind unsere Geschwister, doch dies vergessen immer
mehr Zeitgenossen unter dem Alltagsbrei, welcher heute meist nur
noch aus Zwang zur Erwerbsarbeit einerseits und aus vermeintlicher
Freizeit davor, in Wahrheit ein fast ebenso zwanghafter Konsum von
Freizeitaktivität, ja schon fast wie Instantpulver, besteht.
Unsere Geschwister
auf der Rasenfläche neben dem Hochhaus nehmen viele gar nicht
mehr wahr, nicht die hocherhobene Ursache des Schattens, nicht den
selbstlosen Filter unserer Atemluft, nicht den eigentlichen Bewahrer
vor Verzweiflung angesichts permanenter Beleidigungen für unsere
Augen und Ohren durch die elendig trostlose urbane Gestalt.
Bäume stöhnen auch nicht wenn sie verletzt werden oder
wenn sie im Sterben liegen. Wer hat noch Antennen von uns Menschen,
um deren Not neben unserer eigenen zu spüren?
Autofahrer parken bedenkenlos auf den Wurzelscheiben, Akademikerinnen
schütten das Wischwasser mit Reinigungskonzentrat bedenkenlos
ins Pflanzbeet neben ihrer Eigentumswohnung, Kommunalarbeiter verstümmeln
Großbäume und töten sie so, weil der behutsame und
begleitende Schnitt 30 Jahre lang aus Unkenntnis unterlassen wurde,
usw.
In der vorletzten
Woche lebte ich 14 Tage in München und hätte eine ganze
Fotoserie zu dem Thema schießen können. Doch die Kamera
war meist nicht dabei.

Hier etwa hatte
die Hausverwaltung eine Platane als Schilderhalter gewählt,
aber nicht bedacht, dass diese auch ein Dickenwachstum bekommt.

Also bin ich mit einem Schraubenzieher hoch gestiegen und habe die
Schraube so weit als möglich zurück gedreht.
Jetzt sind wieder 3 Zentimeter Luft zwischen Stamm und Schild. Am
liebsten hätte ich das Schild ganz abgeschraubt und weggeschmissen,
doch womöglich hätte man sich als Ersatz noch etwas weniger
Akzeptables einfallen lassen.
Hoffentlich kommt
in zwei/drei Jahren wieder jemand mit Augen für Bäume
und einem Schraubenzieher dort vorbei.
30.08.08
Nach dem gestrigen
Kommentar noch eine Anmerkung zu Tiefensees Aufruf an die Bau- und
Baustoffbranche, mehr Anstrengungen für den Klimaschutz
aufzubringen, und ein schönes Beispiel für Milchmädchenrechnungen
innerhalb allgemeiner Externalisierungspraxis der Gegenwartsökonomie.
Immer mehr Baustoffe, die früher wie selbstverständlich
in Deutschland abgebaut und bearbeitet wurden, werden aus dem Ausland
importiert. Hier handelt es sich in erster Linie um edlere Steinbruchprodukte
wie Dachschiefer, Pflastersteine, Natursteinplatten oder Materialien
für Steinmetz- und Fassadenarbeiten.
Vor fast 30 Jahren
wurde der Marktplatz meiner Heimatstadt mit Pflastersteinen aus
Norditalien, einem hellgrauen Basaltgestein, gestaltet. Dieses Material
war damals am billigsten, und die verschuldete Kommune war auch
per Gesetz zu dieser Wahl gezwungen. Heute weisen diese importierten
Steine deutliche Frostschäden auf, zerbröseln immer wieder
und müssen nachgearbeitet werden, und man erkennt langsam,
dass das billigste Angebot auch das wertloseste war.
Besonders pikant ist dabei die besondere Rolle der Stadt in Punkto
Pflastersteinherstellung. Seit mehr als hundert Jahren wird in den
Steinbrüchen um die Stadt ein sehr wiederstandsfähiges
Gestein, ein grauschwarzer Melaphyr abgebaut. Bis in die 1960er
Jahre hinein verwendete man dieses Material, neben der Verwendung
als Mauersteine, vor allem zur Herstellung von Pflastersteinen.
Viele Männer der Stadt fanden ihr Auskommen, indem sie mit
angeeignetem Geschick und Erfahrung mit wenigen Schlägen Pflastersteine
in allen Größen herstellten. Mit Lederschürzen saßen
sie zu mehreren unter entsprechenden Schuppen. Vorschläger
richteten das angelieferte, abgesprengte Gestein mit großen
Hämmern und eisernen Keilen in kleinere Brocken. Sie erkannten
sofort die für Laien nicht sichtbaren Schwachstellen und Linien
im Stein, entlang derer man mit geringstem Kraftaufwand genau das
gewünschte Durchreißen bewirken konnte. Eine Schmiedehütte
hielt sämtliche Werkzeuge im immer optimal scharfen Zustand.
Die Steine wurden als Belag für schwer beanspruchte Straßen
mit der Eisenbahn in etliche Regionen geliefert. Überall war
die Investition in dieses langlebige Material als sehr lohnenswert
bekannt.
Heute, und nachdem durch die Konkurrenz mit maschinenerzeugten Billigsteinen
die Kirner Plastersteinproduktion unrentabel geworden war, wird
aus dem hervorragenden Material nur noch Split und Schotter hergestellt.
Eigentlich ist dies eine Verschwendung inländischer Ressourcen.
Doch die verzerrte, gegenwärtige Art von Wettbewerb innerhalb
der externalisierenden Ökonomie, zwingt zu diesem Ergebnis.
Pflastersteine
kommen heutzutage auch nicht mehr aus Norditalien, diese Region
ist mittlerweile im Zuge der sogenannten Globalisierung ebenfalls
abgehängt, nein, sie kommen aus China.
Wenn die Tonne Granit beispielsweise trotz des enormen Transportaufwands
um die halbe Erde bei uns nur 200 Euro, gegenüber 1200 Euro
für heimischen Granit kostet, werden jegliche Qualitätsanforderungen
über Bord geworfen. Was die Chinesen liefern, ist teilweise
so miserabel, dass es in deutschen Brüchen nur die Halde hinuntergeschüttet
werden würde.
Die Quittung für
diesen praktizierten Aberwitz der herrschenden Ökonomie zahlt
natürlich die Allgemeinheit und die nachfolgenden Generationen.
Externalisiert werden in solchen Fällen etwa:
--- Die Umweltschäden durch die sehr viel rücksichtsloseren
Abbaumethoden in China.
--- Die sozialen und menschenrechtlichen Schäden durch Kinderarbeit,
Sträflingsarbeit oder sonstige Ausbeutungsformen zur Rohstoffgewinnung
innerhalb des totalitären Staatskapitalismus dort.
--- Die Umweltschäden durch den gesamten Transport nach Deutschland,
inklusive der anteiligen Schäden durch den Aufbau und die Unterhaltung
der notwendigen Transportinfrastruktur.
--- Die gesellschaftlichen und haushaltstechnischen finanziellen
Folgeschäden in Deutschland durch den sehr viel früheren
Reparaturbedarf der gepflasterten Flächen, bzw. den kompletten
Ersatz nach, angesichts von Erfahrungen mit sorgfältig materialgerecht
produzierten deutschen Steinen, nur einem Bruchteil der erwarteten
Haltbarkeit.
--- Die sozialen Schäden, regional wie gesamtstaatlich, durch
den Verlust der Nachfrage im Inland, also Einbußen für
die Steinbruchbetreiber, Abbau von Arbeitsplätzen im Steingewinnungssektor
und damit entstehende Einbußen und Kosten der Arbeitslosigkeit.
--- Weltpolitische Schäden durch Verzerrung von Wertigkeiten
nationaler Ressourcen, Machtgewinn durch ungerechtfertigte Importeinnahmen
für ein totalitäres Staatssystem, Schwächung der
Deutschen Wirtschaft und der Möglichkeiten zu autarker Versorgung,
daraus folgend: politische Folgekosten durch Einschleichung einer
subtilen Erpressbarkeit,...
--- und anderes mehr...
Würden
alle diese Faktoren monetarisiert werden, also in Euro und Cent
ausgerechnet, und dem Preis für den chinesischen Granit aufgerechnet,
dieser wäre mindestens doppelt so teuer, wie der deutsche Granit.
Was daraus folgte, kann man sich denken.
Das Argument, welches manchen eventuell in den Sinn kommen könnte,
etliche Flächen könnten dann überhaupt nicht mehr
gepflastert werden, weil das Material zu teuer käme, entbehrt
im Konzept von der Kategorischen Marktwirtschaft jeglicher Grundlage.
Erstens würden die vom Importeur verlangten Internalisierungseinnahmen
ausgezahlt werden, zweitens und vor allem aber würde die komplett
geänderte Wertigkeit innerhalb der Ökonomie den bezahlbaren
Erwerb von guten Plastersteinen genauso ermöglichen wie dies
vor 50 Jahren in Deutschland völlig selbstverständlich
erschwinglich war.
Man müsste nämlich für die Steine nur einmal bezahlen
und nicht wie heute, zuerst den globalisierungstechnisch niedrig
subventionierten Scheinpreis und dann über viele Jahre verteilt
alle doch wieder zurückkommenden Folgeschäden der Externalisierung.
29.08.08
Bundesbauminister
Tiefensee (SPD) hat am Dienstag die Baubranche zu mehr Anstrengungen
für den Klimaschutz aufgerufen. Besonders die Baustoffindustrie
sei gefordert, neue Technologien und Baumaterialien für eine
klimafreundliche Sanierung älterer Gebäude anzubieten.
Einerseits kann
ich als Bauökologe, als jemand, der nach Wegen zu umwelt- und
anwendungsfreundlichen, wie bezahlbarem Bauen sucht, ein Lied vom
Mangel an entsprechenden Materialien und Techniken singen.
Andererseits weiß ich um die Aussichtslosigkeit von Vorne
herein, wenn man sich von Regierungsseite mit Appellen und Aufrufen
an die Industrie wendet.
Was ist Tiefensees Vorstoß denn anderes, als folgenlose Wichtigtuerei?
Praktisch gesehen
habe ich derzeit das Problem, einen geeigneten Baustoff zur Außenisolierung
eines Anbaus aus den 1960er Jahren zu finden. Mehrere Materialien
bieten sich an, wobei bei jedem allerdings mindestens ein großer
Nachteil akzeptiert werden muss.
Styropor ist am billigsten und hat einen sehr guten Dämmwert,
wird aber als Erdölprodukt unter erheblicher Umweltbelastung
hergestellt, verteilt sich beim Einbau teilweise in winzigen Bröckchen
in die Landschaft, dünstet schädliche Gase aus, kann nicht
recycelt werden und liefert im Brandfalle giftige Rauchschwaden
an die Umgebung. Außerdem diffundiert keine Feuchtigkeit hindurch,
was bauphysikalisch von erheblichem Nachteil ist, und der Verputz
kann wiederum nur mit Kunstharzprodukten erfolgen.
Fast alle biologischen Baustoffe können nur in einen Kasten
aus Rahmenschenkel verbaut und dieser mit hinterlüfteter Holzschalung
abgedeckt werden, was einen großen Aufwand zusätzlich
zum hohen Preis des Dämmstoffs bedeutet.
Was mir derzeit bleibt, sind Platten aus Mineralschaum, einem Material,
ähnlich den Ytongsteinen, nur weicher und leichter. Diese dämmen
einigermaßen gut, falls man mindestens 16 mm Dicke wählt,
können mit Leichtmörtel aufgeklebt werden, sind diffusionsoffen
und mit Kalkmörtel verputzbar, ungiftig und recycelbar. Allerdings
brauchen sie viel Energie zur Herstellung, und sie sind sehr teuer.
Ich sehne mich
nach Baustoffen, die aus regionalen Rohstoffen produziert werden
können, besonders zur Wärmedämmung. Hier gibt es
derzeit nur enorm arbeitsaufwendige Verfahren von Selbstbauern,
wie Lehmbauformen und unkonventionale Dämmarten mit Holzspänen,
Rindenhäcksel, oder verschiedenen Pflanzenfasern.
Die Industrie liefert hier bis heute nichts wirklich geeignetes.
Bei den Hanfmatten etwa, mit denen unser Dach gedämmt ist,
musste ich zähneknirschend die enthaltenen 10 % Polyesterstützfasern
und den hohen Preis akzeptieren. Der Einbau war sehr aufwendig,
weil die Setzneigung mit einem 3-lagigen Einbau kompensiert werden
muss und die Matten später, weil nicht biologisch recycelbar,
werkstofflich wiederverwertbar bleiben sollten.
Bei allen auf
dem Markt befindlichen Dämmstoffen und Dämmsystemen sagt
der Preis nichts über die tatsächliche Eignung unter Berücksichtigung
wirklich aller dazugehöriger Facetten aus.
Die umweltschädlichsten Dämmstoffe sind derzeit die billigsten.
Wenn sie auch meist sehr gute Dämmwirkungen zeigen, also übermäßigen
Energieverlust und die damit verursachten Umweltbelastungen recht
effektiv vermindern, ist ihre Gesamtbilanz trotzdem arg geschönt,
weil viele ökologischen und auch sozialen Folgekosten unberücksichtigt
bleiben und nicht im Preis erscheinen.
Auch der recht unterschiedliche Aufwand zum Einbau des Dämmstoffs,
kommt nur sehr verzerrt zum Ausdruck. Ökologisch betrachtet
ist ein hoher handwerklicher Aufwand viel eher zu akzeptieren, als
ein hoher technischer bei der Herstellung. Ersterer bringt Arbeitsplätze,
stärkt die regionale Rohstofferzeugung oder schont die natürlichen
Ressourcen.
Hoher Arbeitsaufwand allerdings ist im herrschenden Wirtschaftssystem
teuer, weil dem direkten Konkurrenten menschlicher Arbeitskraft,
der technischen Arbeitsleistung in Form von energieintensiver Produktion,
großem Transportaufwand oder bedenkenloser Abfallnebenproduktion,
bei weitem nicht der vollständige gesellschaftlich angemessene
Preis zugeordnet ist.
Über die
reine Betrachtung von Dämmstoffen und nötigem Arbeitsaufwand
hinaus, muss man schließlich auch die Möglichkeiten zu
völlig neuartigen Konstruktionen betrachten, in welchen die
Trennung zwischen ungedämmter Bausubstanz und aufgebrachter
Dämmschicht aufgelöst ist und beides schon bei der Planung
zusammengedacht und entsprechend konstruktiv gelöst wird. Dieser
Aspekt wird beispielsweise in der passiven Solarbauweise, bei Berücksichtigung
von vorherrschenden Windströmungen und anderen lokalen Gegebenheiten
etwa umgesetzt.
Auch auf diesem Feld liefert die Bau- und die Baustoffindustrie
bis heute fast nichts geeignetes. Wenn überhaupt, ist dies
nur von Spitzenverdienern bezahlbar.
Wie will Tiefensee
hier das Notwendige anstoßen, wenn er einen peinlichen Appell
loslässt, offenbar nur genötigt von der aktuellen Klimadiskussion.
Wirklich klimafreundliches Bauen bekommen wir nur mittels eines
entsprechenden marktwirtschaftlichen Wettbewerbs. Diesen aber bekommen
wir nur mittels der Instrumente der Kategorischen Marktwirtschaft.
Würde Herr Tiefensee es wirklich ernst meinen, müsste
er sich dieser Instrumente bedienen.
28.08.08
Heute vor 175
Jahren wurde die Sklaverei in den Britischen Kolonien
abgeschafft. Es ging dem ein langer Kampf der Bewegung gegen
Sklavenhandel und Sklaverei, dem Abolitionismus voraus. Ursprünglich
von der christlichen Vereinigung der Quäker gegründet,
schaffte sie es 1833 mittels allerlei Petitionen, Veranstaltungen,
Vorträgen und Boykotten von Importwaren, das Britische Parlament
zu überzeugen.
Fast 200 Jahre lang, seit 1619, wurden Schwarzafrikaner von der
westafrikanischen Küste aus nach Nordamerika verschleppt.
Nachdem schon 1807 der Sklavenhandel auf britischen Schiffen untersagt
worden war, gingen sklavengestützte Wirtschaftszweige bis 1833
kurzzeitig zur Versklavung der Nachkommen von bereits vorher verschleppten
Sklaven über.
In den USA wurde die gesetzliche Abolition dann 1863/65 erlassen,
in den Nordstaaten schon 1804.
In französischen Kolonien war 1848, in niederländischen
1863 und in der portugiesischen Kolonie Brasilien 1888 offiziell
Schluss mit der Sklaverei.
Sehr viel früher war auf Druck der katholischen Kirche in den
spanischen (1542) und portugiesischen (1570 bis 1758) Kolonien die
Versklavung der Indianer verboten worden, was dann aber lediglich
zum Sklavenhandel mit afrikanischen Menschen über den Atlantik
geführt hatte. Gegen diesen hatte sich die Kirche nicht ausgesprochen.
Seit dem Altertum
bildete die Sklaverei eine entscheidende Wirtschaftsgrundlage. Diese
Form der Ausbeutung Dritter zum eigenen Vorteil kann seit den altorientalischen
Kulturen Vorderasiens nachgewiesen werden. Im antiken Griechenland
nahm die Sklaverei seit dem 6 Jahrhundert v. Chr. größere
Ausmaße an. Das römische Reich versklavte seit dem 2
Jh. v. Chr. Angehörige unterworfener Völker zu Millionen.
Über 2000
Jahre lang wurde Sklaverei ohne Bedenken praktiziert. In Saudi-Arabien
schaffte man sie erst 1963 ab.
Derzeit existiert
wie selbstverständlich, noch wenig bemerkt und kaum im
öffentlichen Bewusstsein angekommen, eine andere mächtige
Form der Ausbeutung Dritter, um auf diese Weise kurzfristige
wirtschaftliche Vorteile zu erreichen.
Ja diese Form der Ausbeutung ist die wichtigste Grundlage des derzeitigen
sozialen und ökonomischen Systems in allen Ländern der
Welt.
Gemeint ist die Verursachung von ökologischen und sozialen
Schäden innerhalb unseres gegenwärtigen Wirtschaftssystems
und die Abwälzung dieser Schäden auf die Menschengenerationen
der Zukunft.
Diese Menschen sind die Sklavenheere der Gegenwart. Ihre Befreiung
wäre gleichbedeutend mit der Abschaffung jeglicher Möglichkeiten
zur Kostenexternalisierung in der Wirtschaft, bzw. mit der vollständigen
Internalisierung dieser Kosten in die Preise aller Produkte und
Dienstleistungen.
Eine entsprechende
Abolitionsbewegung, wie Anfang des 19ten Jahrhunderts durch die
Quäker gegenüber der Sklaverei initiiert, existiert derzeit
noch nicht.
Zukunftslobby bemüht sich um die Schaffung des entsprechenden
Bewusstseins, das einer starken Bewegung zur Änderung jahrhundertelang
eingeschliffener Irrwege voraus gehen muss.
Wünschenswert wäre, hierzu noch einige engagementbereite
Mitstreiter zu finden. Meldet euch!
27.08.08
Ein Bekannter
von mir ist Besitzer eines kleinen Sägewerks in der Pfalz.
Gestern war ich bei ihm, weil er ein paar Restbestände Buntholz
für mich hatte, Abfälle und kleine Stücke, die in
der Holzwerkstatt meiner Frau und mir noch gut zu verarbeiten sind.
Als der Anhänger voll geladen war, unterhielten wir uns noch
eine Zeit lang über die politischen Gegebenheiten und die wirtschaftliche
Situation von Kleinunternehmern in der Holzverarbeitung.
Die Möglichkeiten für kleine Sägebetriebe, mit dem
Einschnitt von Bauholz Geld zu verdienen, sind praktisch völlig
zusammengebrochen. Bauholz kommt nur noch aus Großsägereien
oder aus dem Ausland. Für Kleinbetriebe lohnt sich der Aufwand,
selbst zu schneiden, nicht mehr. Sie zahlen beim Kauf von fertig
geschnittenem Holz etwa den gleichen Preis, als würden sie
selbst sägen.
Viele kleine Sägereien sind in der letzten Zeit Bankrott gegangen.
Wer jetzt noch arbeitet, kann dies nur durch Einrichten einer bestimmten
Nische, durch Bedienung einer ganz speziellen Nachfrage oder Kombination
des Sägegeschäfts mit verwandten Sparten. So sind Sägereien
heute auch Holzhändler, fertigen Gartenmöbel, bieten seltene
Holzarten an, haben mit Zimmereien fusioniert, liefern Brennholz
oder haben ein Transportgeschäft dazu genommen.
Bei den Großsägereien indes, findet ein weiterer Wandel
statt. Es entstehen große Konzentrationen wie Sägewerksketten,
und die Ausdünnung der Sägewerksinfrastruktur in waldreichen
Regionen Deutschlands schreitet immer weiter fort. Der Transportaufwand
für Stammholz steigt stetig an und mit ihm die ökologischen
Schäden, die durch die Verarbeitung des ursprünglichen
Naturbaustoffs verursacht werden.
Der Arbeitskräftebedarf pro Holzeinheit sinkt kontinuierlich
ab und mit ihm die Verdienstmöglichkeiten für die dort
noch beschäftigten. Die Zeiten, wo ein ertragreicher Wald auch
vielen Leuten in der Region Arbeit und Brot bescherte, scheinen
wohl endgültig vorbei zu sein.
Mittlerweile werden auch schon Großsägereien von chinesischen
Unternehmern übernommen. Der Irrsinn von vor ein paar Jahren,
wo verstärkt deutsches Stammholz, vorwiegend helles Buchenholz,
nach China exportiert wurde, erfährt noch eine Steigerung,
da diesen Export und die Vorverarbeitung die Chinesen jetzt in Deutschland
in eigenen Anlagen zunehmend selbst erledigen.
Überdies
wären noch eine Vielzahl von Details aufzuzählen, wie
sich die Landschaft der heimischen Holzsparte verändert hat
und noch verändert. Beispielsweise haben etliche Sägewerksbesitzer
das Problem, sich mit weltfremden Kommunalpolitikern herumschlagen
zu müssen. Ein Werk etwa, um welches herum in den 1980ziger
und 1990ziger Jahren ein Neubaugebiet gewachsen ist, wird bedrängt,
auszusiedeln und die Fläche herzugeben, das aber im Jahr 2008,
wo die Bautätigkeiten fast völlig zum Erliegen gekommen
sind, wo kaum jemand mehr Geld zum Bauen hat, geschweige denn den
Mut dies zu tun, wo Bauplätze in Deutschland außerhalb
der Metropolen wie sauer Bier angeboten werden. Viel zu viele Bürgermeister
und Stadt- und Landräte haben dies immer noch nicht begriffen
und betreiben stur eine Politik, wie im letzten Viertel des vergangenen
Jahrhunderts.
Und warum diese
ganze fatale Entwicklung, hier mal speziell im gewachsenen Holzverarbeitungssektor
beschrieben?
Weil unsere herrschende Ökonomie keine nachhaltige ist, weil
sie auf rein quantitatives Wachstum setzt, weil die Menschen und
Regionen ihr völlig egal ist, weil der Wert der natürlichen
Lebensgrundlagen missachtet wird, weil die Ideologie vom wirtschaftlichen
Wettbewerb die grundlegenden Lebensbedürfnisse ausblendet und
nur auf ausgewählte Zahlen schielt, kurz gesagt: weil ökologische
und soziale Schadkosten in der herrschenden Ökonomie ausgeblendet
werden können, statt in den Preisen zu erscheinen.
Gesunde kleine
Sägewerke vor Ort, mit Beschäftigten, die um die Ecke
wohnen und die Baumstämme aus dem heimischen Wald verarbeiten,
bekommen wir nur wieder mittels der Kategorischen Marktwirtschaft.
26.08.08
Die Kanzlerin
reist in die baltischen Staaten. Dort wird sie sich hauptsächlich
deren Sorgen gegenüber dem mächtigen Nachbarn Russland
anhören. Was der Putinstaat sich mit Georgien erlaubt
hat, hat eine große Angst erzeugt.
Aber ebenso ratlos wie fassungslos steht derzeit die ganze Weltgesellschaft
da. Was ist zu tun gegenüber Russland, das sich in dem Motto
sonnen kann: "Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich´s
völlig ungeniert."?
Den Europäern
fällt nur der Ruf nach der Nato ein. Georgien soll bald Mitglied
werden können. Doch diese Möglichkeit ist hochgefährlich.
Soll Russland damit nur von einer Intervention abgeschreckt werden,
oder soll im Falle einer Intervention in einem Natoland dann Russland
angegriffen werden?
Sakaschwilli, der hitzköpfige und kurzsichtige Vasall westlicher
Ideologie, könnte auch innerhalb der Nato wieder den Kopf verlieren
und mittels eines unüberlegten Militäreinsatzes, wie in
Südossetien, ins russische Messer laufen. Ja eine Mitgliedschaft
könnte ihn gar bestärken, dies zu tun. Wäre Georgien
in der Nato, hätte er einen Großteil der Welt mit in
seinen Konflikt gestürzt.
Ebenso wäre die Natomitgliedschaft auch keine Garantie für
eine diplomatische Lösung solcher territorialer Streitigkeiten.
Europa hat Georgien in der Frage Abchasien und Ossetien nicht unterstützt.
Ein intensiver diplomatischer Beistand, fixiert auf eine beiderseitige
Lösung des Konflikts, hat nie stattgefunden. In solchen Angelegenheiten
würde eine lediglich gebietsmäßig erweiterte Nato
das Geschick Europas keinesfalls verfeinern.
Den Kritikern
Putins in Europa fehlt etwas sehr entscheidendes. Sie haben gegenüber
Russland kein wirkliches Druckmittel.
Mit allerlei Wortgetöse versucht man dieses Manko zu übertünchen.
Manche öffentlichen Verurteilungen Russlands grenzen dabei
schon an offene Peinlichkeit, auch weil das angerichtete Kosovodebakel
den Westen beim Argumentieren behindert.
Das merkt Putin doch, wieder einmal mehr kann er sich ins Fäustchen
lachen. Wieder einmal mehr bestärkt ihn dies in seinem Gefühl,
Machtdemonstrationen, oder wie er es offenbar sieht Vergeltungsaktionen,
nach seinem Geschmack konsequenzlos durchziehen zu können.
Was wäre
aber, wenn Europa auf den Gasnachschub aus Russland verzichten könnte?
Was würde in Putins Kopf zusammenfallen, wenn Europa auf die
Güter aus dem großen rohstoffreichen Land notfalls weitgehend
pfeifen könnte, ohne dabei in eine gefährliche Krise zu
fallen?
Die eigenständige Energieversorgung für Europa ist durchaus
möglich. Ebenso kann die Versorgung mit fast allen sonstigen
Rohstoffen mittels entsprechendem Umbau des Wirtschaftssystems autark
innerhalb Europas organisiert werden.
Fazit: Auch außenpolitisch,
dies zeigen die Hintergründe der Russland-Georgien-Krise, besteht
die Notwendigkeit für Europa, endlich eine wirklich nachhaltige
Ökonomie umzusetzen.
Außenpolitisch wird Europa nur stark werden können, wenn
es die Abhängigkeiten von instabilen Weltregionen, welche in
naiver Weise in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurden, wieder
abbaut. Dies gelingt aber nur mittels eines entsprechenden Umbaus
des Fundaments unserer Marktwirtschaft, dies gelingt nur mit der
Kategorischen Marktwirtschaft.
Ja mit ihr würden gar die Verhältnisse von benachbarten
Staaten wie Russland und Georgien auf andere Fundamente gesetzt
werden. Weil das naheliegenste zum finanziell Günstigsten würde,
weil Energie- und Rohstofflieferungen weniger elementar wären
und weil die Regionen stark aufgewertet würden, bekäme
das Interesse am nachbarschaftlichen Handel einen entscheidenden
Aufschwung, und die Neigung zur Blockanlehnung würde den großen
Reiz verlieren.
25.08.08
Während
der letzten 14 Tage war ich wegen einer Renovierung in München.
Dort wohnte ich in einem Schwabinger Haus aus Eigentumswohnungen
im dritten Stock, sehr nett und relativ ruhig mit etwas Grün
vor den Fenstern.
Sehr interessant war, dass der Zeitungsausträger an jedem
Morgen unten im Flur eine Ausgabe der Tageszeitung "Die
Welt" aus dem Springerverlag hinterlegte. Die wanderte
regelmäßig in den Müll, da die Leute dort offensichtlich
alle lieber "Süddeutsche" lesen, also erbarmte ich
mich und schaute während des Frühstücks, weil sie
halt schon mal da war und nichts kostete, eben in die "Welt".
Natürlich
bekommt man auch aus dieser Zeitung die alltäglichen Presseinfos.
Doch es fällt sehr auf, wie stark diese "Bildzeitung für
Teilintellektuelle" im Prinzip meist durch Halbwahrheiten die
entsprechenden Statements zustande bringt. Die Redakteure blenden
einfach einige Aspekte des zu behandelnden Themas aus, um auf diese
Weise zu den altbekannten strukturkonservativen und kapital- wie
industriefreundlichen Schlussfolgerungen zu gelangen.
Diese Vorgehensweise zieht sich wirklich, mit nur wenigen Ausnahmen
im Feuilleton beispielsweise, permanent durch dieses Blatt. Man
erkennt nicht genau, ob dies mit Absicht geschieht, oder ob die
Schreiber ganz einfach mit fest angewachsenen Scheuklappen durch
die Wirklichkeit tappen und nur in der Lage sind, ihren idelogischen
Tunnelblick wieder zu geben.
Gutes Beispiel
hierfür war am 12. August ein Erbrechnis von Redakteur Michael
Miersch. Dieser Pamphleteur ist auch des öfteren schon
als sogenannter "Klimaskeptiker" zusammen mit Dirk Maxeiner
in Erscheinung getreten. Zusammen haben sie ein Buch geschrieben,
in welchem sie die Klimaerwärmung als menschengemachten Effekt
schlichtweg ableugnen.
Nun ja, wenn man sich nicht mit einem vernünftigen Thema einen
Namen machen kann, tun es gewisse Leute eben, indem sie sich als
Arschloch outen. Jedem das Seine.
Miersch jedenfalls
hat am 12. auf der ersten Seite, Spalte rechts oben einen Kommentar
mit der Überschrift "Bio ist nicht besser"
stehen.
Hier versucht er darzustellen, dass biologisch erzeugte Kost nicht
wertvoller sei als konventionell erzeugte Nahrung. Er führt
Untersuchungen zu den Inhaltsstoffen auf, gibt beiläufig mal
zu, auf Bioobst und Biogemüse würden wohl weniger Pestizidreste
haften, aber diese auf konventionellen Früchten währen
ja übers Jahr weniger, als in einer einzigen Tasse Kaffee.
Ob dies dann Kaffe aus dem Bioanbau oder dem giftstrotzenden Anbau
sei, sagt Miersch dann nicht, auch nicht, welcher Gesinnung seine
Quelle, einer der "führenden Umweltwissenschaftler Amerikas"
(Miersch) Bruce Ames denn ist, und wes Brot dieser Mann isst.
Den üblen
Kommentar kann Miersch aber letztlich nur bringen, weil er von den
beiden ersten Gründen für Bioanbau den viel wichtigeren
einfach verschweigt.
Neben der Gesundheit für die Konsumenten spricht doch für
biologisch erzeugte Waren in erster Linie, dass damit die natürlichen
Lebensgrundlagen am Ort des Anbaus geschont werden.
Für mich ist vor allem wichtig, dass für meine Nahrung
so wenig wie möglich Boden, Wasser und Luft mit Schadstoffen
belastet wird. Dies bedeutet, Pflanzen müssen ausschließlich
ohne Pestizide angebaut und ohne großen Transportaufwand zu
mir gebracht werden können.
Dass Biokost meinem Körper weniger schaden kann als konventionelle
Nahrung ist für mich zwar auch wichtig, aber eher zweitrangig.
An erster Stelle muss meine Verantwortung gegenüber Dritten,
gegenüber den natürlichen Lebensgrundlagen von Dritten
stehen. Meine eigene Existenz darf auf keinen Fall zu Schädigungen
von Böden, von Wasser und von Luft und nicht zu Müll führen,
womit andere Menschen dann ein Problem bekommen.
Dies ist der Hauptgrund
für Bio, Herr "Weltredakteur" Miersch. Man braucht
aber wohl nicht zu hoffen, dass diesem Betonkopf noch irgendeine
relativierende Einsicht oder ein Anflug von Verantwortungsgefühl
gelingt.
Urlaub vom 11. bis 24.
August
10.08.08
Ein zweites Mal
in dieser Saison haben Rotschwänzchen im neuen Dach unseres
Anbaus Junge bekommen.
Nachdem die Eltern emsig durch die noch offenen Fensteröffnungen
hin und her flogen und ein kräftiges Geschrei vom Firstbalken
herunter etliche hungrige Jungvögel versprach, waren dann ab
Anfang vergangener Woche zwei Junge aus dem Nest geraten.

Ihr Glück
war, dass sie im ersten Stock nun zwar auf dem Boden saßen
und nicht mehr auf dem Firstbalken, aber dass sie dort immer noch
sicher vor Raubtieren waren. An den Wänden außen konnte
keine Katze hochkrabbeln.

Zunächst drückten
sich die beiden jungen Rotschwänze zwischen die noch auf dem
Boden liegenden Gerüstbauschrauben und Eisenkonsolen.
Ununterbrochen wurden sie von den Elternvögel weiter mit Futter
versorgt.

Dann hatten sie
irgendwann auch mein Nest aus Flachsfasern angenommen. Hier saß
es sich doch wärmer, als auf dem Betonboden und ans Metall
geschmiegt.
Gestern Nachmittag
wurde dann etwas anders. Die Eltern saßen häufiger auf
den Dachkanten der Schuppen außerhalb und flogen auch seltener
in den Anbau hinein. Ihr Geschrei wurde intensiver,
ein Wechsel zwischen dem eher geduldigen "wieht, wieht, wieht,
..." und einem heftigen Geschnatter, ähnlich dem des Delphinen
"Flipper" in der Fernsehserie.
Als ich abends in den Anbau ging, fand ich die Jungen nicht mehr.
Offensichtlich hatten sie es geschafft, nach draußen zu fliegen.
Dafür fiel mir auf, dass die beiden Nachbarkatzen unten herum
schlichen.
Heute früh saß ein Elternvogel noch immer auf dem Dach
gegenüber und rief, doch kein Junges war mehr zu finden.

Am Boden unten
fand ich nur noch ein Federbüschel,

und einige einzelne
Flügelfedern, und man kann sich denken, was sich hier wohl
abgespielt hat --!
Katzen sind
Mörder. Das muss man kompromisslos so sagen. Sie haben
den ganzen Tag Zeit um umherzuziehen und kleinere Tiere zu töten.
Früher waren Katzen wohl einmal wichtig gewesen um die gelagerten
Getreidevorräte vor Mäusen zu schützen. Heute aber
sind sie völlig nutzlos, und wenn sie wie hier auf dem Dorf
nicht nur in der Wohnung gehalten werden, sind sie unzweifelhaft
schädlich für die Natur.
Einen Hund darf der Besitzer im Wald nicht frei laufen lassen, weil
er wildern würde.
Für Katzen gibt es solche Überlegungen nicht. Wieso eigentlich
nicht? Sind ihre Opfer denn weniger wert, weil sie kleiner sind?
Werden Waldtiere beachtet, weil sie für die Freizeitjäger
und Jagdpächter wichtig sind?
Für mich und meinen Garten sind Vögel, Frösche, Wiesel,
Siebenschläfer, Spitzmäuse, Eidechsen und was ich noch
alles in den letzten Jahren getötet auf meinem Grundstück
so finden musste, wichtig, wichtiger jedoch, als Nachbars Schmusetiger.
Doch ich bin, angesichts dieses großen, aber kaum im Bewusstsein
der Menschen stehenden Problems, machtlos. Ich muss die Lust von
Katzen am Töten hinnehmen, ebenso wie die Gleichgültigkeit
ihrer Halter.
09.08.08
Die Eröffnungsfeier
der Olympiade in Peking war wie man hörte, ein nie dagewesenes
Spektakel.
Mit erstaunlichen, teils martialischen Darbietungen, meinen die
Chinesen offensichtlich sich ein für alle Mal ins Bewusstsein
der übrigen Welt einbrennen zu können.
Mit eingebrannt wird damit allerdings auch der Makel, dass eine
Diktatur sich um so stärker mit Äußerlichkeiten
schmücken muss, je erbärmlicher sie im Inneren demokratische
Selbstverständlichkeiten herausgebildet hat.
Sechs Stunden
mussten Journalisten bei 34 Grad und annähernd gesättigter
Luftfeuchtigkeit im neuen Pekinger Stadion gestern schwitzen, sofern
sie nicht das Glück hatten in einer klimatisierten Promizelle
zu sitzen, nur um dann sagen zu können: Dies war einfach zu
lang.
Die Wettermacher um die Metropole hatten gestern ihren ersten Einsatz.
Mit tausend Silberjodidraketen brachten sie ein Gewitter bereits
vor der Stadt zum Abregnen.
Die nächste Superlative soll die Führung Chinas im Medaillenspiegel
werden. Erstmals will man die Amerikaner von Platz Eins verdrängen.
Mit unglaublichem Aufwand betreibt China nicht nur den ultimativen
Sieg im Sport und im Wettkampf um den äußerlich beeindruckendsten
Anschein und der Organisationstiefe der Spiele. Auch dem Ansehen
Chinas innerhalb der Staatengemeinschaft soll dies natürlich
helfen.
Welch ein fataler
Irrtum. Indem das Falsche noch gründlicher und ausgedehnter
umgesetzt wird, als es die westlichen Staaten schon länger
betreiben, wird China sich keine dauerhafte Achtung verschaffen
können. Das optisch Bewundernswerte an den Spielen wird schnell
vergessen sein, ja es kann sogar zur Grundlage von Spott verkommen.
Was wird wohl übrig bleiben? Der Verkehr in Peking wird wieder
uneingeschränkt fließen, die Industriebetriebe wieder
ungebremst Abgase ausstoßen dürfen.
Der Wunsch, für Olympia den unerträglichen Smog über
Peking mit rigiden Maßnahmen zu reduzieren, wird wohl nicht
in einen Wunsch münden, dies auch dauerhaft zu Gunsten der
Bevölkerungsgesundheit und der natürlichen Lebensgrundlagen
beizubehalten.
Es wird der altbackene, schlechte Geschmack bleiben: China tut alles
für die Fassade "Olympia 2008", aber nichts für
die Menschen und die Zukunft.
08.08.08
Heute werden die
Olympischen Spiele in Peking eröffnet. Zur offiziellen
Feier im "Vogelnest", dem neuen Olympiastadion, sind 80
Regierungschefs angereist, darunter Bush, Putin und Sarkozy. Merkel
ist nicht da, Köhler will lieber zu den Parolympics fahren.
Alle können
dann die Inszenierungen bestaunen, die von der Hauptstadt der größten
Diktatur der Welt für ihre Gäste aufgefahren wurden. Sarkozy
hat nun doch ein Treffen mit dem Dalailama gestrichen, ganz so,
wie es zu diesem erbärmlichen Windmacher und Staatsdilettanten
aus Frankreich eben passt. Der Einzige ist er ja nicht, der sich
lieber von den mächtigen Parteichinesen hofieren lässt
und den Blick hinter die aufgestellten Kulissen tunlichst vermeidet.
Neben den Kulissen
der Zensur gibt es in Peking jede Menge erbauter Kulissen.
Als real sichtbare Wände aus Stein und Metall ziehen sie sich
kilometerlang vor alten Stadtteilen und kleinzelligen Wohnregionen
hin und verbergen gewachsene Stadtviertel, die nicht wie in letzter
Zeit so viele andere einfach abgerissen wurden.
Allesamt wurden sie erst in den letzten Monaten erbaut, vor allem
dort, wo ausländische Gäste sich bewegen könnten,
wo Rennstrecken entlang führen oder wo es sonst noch Grund
für ausländische Reporterteams geben könnte, mit
der Kamera drauf zu halten.
Innerhalb dieser etwa drei Meter hohen Kulissenbänder glitzert
die Stadt. Hier wurden, seit Peking als Austragungsort für
2008 feststand, in Windeseile Hochhäuser und andere futuristisch
aussehende Gebäude hochgezogen, eine Skyline, wie in Zentren
anderer bedeutender Metropolen der Welt.
In der ARD lief
ein interessanter Fernsehbericht über diese beiden Ansichten
des modernen Pekings während der Olympiade.
Die Reporter gingen mit der Kamera hinter die Kulissen und fanden
dort Stadtteile, die noch nicht nieder gerissen wurden, um ebenfalls
Großstadtkulisse hochzuziehen.
Auch sieht man die als Touristen verkleideten Spitzel, überall
in der Stadt verteilt, wie sie sich in Menschenmengen unauffällig
geben und dennoch, einmal erkannt, unübersehbar werden.
Den
Beitrag kann man sich noch ansehen und sollte es auch tun, damit
die prächtig geplanten Fernsehbilder der kommenden Wochen ihre
realistische Relativierung finden.
Wer so aufwändige Kulisse aufbauen muss, besitzt ein gigantisch
großes schlechtes Gewissen und hat enorm viel zu verbergen.
07.08.08
Heute Abend
um 22.30 läuft im NDR ein Bericht über die ungewöhnliche
Aktion des TV-Satiremagazins "Extra 3".
Extra
3 will die strenge Internetzensur in China untergraben,
indem es Internetseiten, die dort gesperrt sind, auf der eigenen
Homepage erreichbar macht, Extra3: "Extra
3 bypasses Chinese Censorship".
Dies sind beispielsweise die Seiten von Amnesty International, der
Gesellschaft für bedrohte Völker oder die von der International
Campagin for Tibet.
Die Internetpräsenz von "Extra 3" ist dagegen für
chinesische Netznutzer frei zugänglich. Hierüber können
die zensierten Seiten ab sofort aufgerufen werden.
"Extra 3"-Moderator Tobias Schlegl bezeichnet sein Magazin
als "quasi das U-Boot der Meinungsfreiheit". Schlegl:
"Wir kämpfen mit dieser Idee für die Pressefreiheit".
Amnesty International begrüßte die Idee. Ihr Pressesprecher
Dawid Bartelt sagte: "Die Aktion von 'extra 3' bohrt ein Loch
in die Mauer der chinesischen Zensur. Wir hoffen, dass viele Chinesen
von dieser Möglichkeit erfahren, sich frei zu informieren und
sie nutzen können".
Es stellt sich
jetzt natürlich die Frage, wie lange die Aktion den 60.000
chinesischen Internetzensoren verborgen bleibt.
Schneller, als dass sich die Möglichkeit, Amnesty über
Extra 3 erreichen zu können, in China herumspricht, könnte
wohl auch "Extra 3" selbst auf den Index wandern und fortan
gesperrt sein. Die Aktion hätte dann nur noch einen symbolischen
Charakter behalten und "Extra 3" bekannter gemacht.
Immerhin aber bietet auch der deutsche ChaosComputerClub CCC
eine Internetsite an, mit Wegen, die chinesische Zensur umgehen
zu können:
"The "Chaos Computer Club", a german organisation for
the freedom of information, has published a special internet-site
with possible ways to bypass chinese censorship".
Die Computerprofis vom CCC werden
wohl gegen die Sperrung ihrer eigenen U-Boot-Site chinesewall.ccc.de
entsprechende Vorkehrungen getroffen haben.
Auch das Projekt
picidae.net bietet Möglichkeiten,
die Zensur im Internet zu umgehen. "The project "picidae"
overcomes the firewall in China or arab states. Picidae offers a
complete and readable mirror of the banned sites including links."
Noch interessanter
wäre diese Idee, wenn sie gerade jetzt zur Eröffnungsfeier
der olympischen Spiele in China von den internationalen Sportverbänden
übernommen werden würde.
Die Site vom Olympischen Komitee IOC beispielsweise könnten
die Chinesen derzeit ganz bestimmt nicht sperren, selbst wenn dort,
wie gerade über "Extra 3" eine Brücke zu kritischen
Menschenrechtsorganisationen eingerichtet wäre.
Das IOC, wie auch große Sponsoren, sollten sie ihre Websites
entsprechend einrichteten, könnten einen Großteil des
opportunistischen Gemuffels, das sie derzeit ausdünsten, in
Wohlgeruch verwandeln.
Und die chinesischen Machthaber könnten nur mit den Zähnen
knirschen.
06.08.08
Mit der umfangreichen
Untersuchung deutscher Trinkwasseranalysen auf den Urangehalt hat
Thilo Bode von Foodwatch
einen tollen Coup gelandet. Wieder mal wird ein Versäumnis
des Gesetzesgebers im Bereich Verbraucherschutz und Ernährung
deutlich.
Immerhin
wurde aus der Politik gestern vage signalisiert, dass auch beim
Wasser aus der Leitung Grenzwerte, wie derzeit schon beim Mineralwasser,
eingeführt werden sollen.
In der Trinkwasserverordnung
steht unter § 6, Abs. 1 die Formulierung: "Im Wasser
für den menschlichen Gebrauch dürfen chemische Stoffe
nicht in Konzentrationen enthalten sein, die eine Schädigung
der menschlichen Gesundheit besorgen lassen."
Anlass zur Sorge haben wir in unserer Region schon allein wegen
des hohen Nitratgehalts von über 30 Milligramm, wodurch das
Leitungswasser für Säuglingsnahrung schon nicht mehr geeignet
ist. Diese Sorge hat bis heute nicht zu einer Senkung des Nitratanteils
geführt, ja noch nicht mal zur Einschränkung des permanenten
Neueintrags durch die Verwendung von Mineraldüngern in der
Landwirtschaft.
Auch hier wird die Trinkwasserverordnung schon missachtet, und dies
wohl aus knallharten finanziellen Gründen: Die konventionelle
Landwirtschaft soll ihren ungerechten Wettbewerbsvorteil behalten,
und die Agrarindustrie soll weiter ihren Dünger absetzen können.
Die ökologischen und gesundheitlichen Folgekosten werden in
die Zukunft und auf die Allgemeinheit verschoben.
Nun ist ja die
Trinkwasserverordnung schon ein Gesetz zur Erfüllung einer
EG-Richtlinie. Ohne EG wäre diese vielleicht gar nicht so deutlich
formuliert worden. Nun ja, wenn sie eh´ nicht beachtet wird,
ist´s ja einerlei.
Was beim Thema Uran allerdings Hoffnung macht, ist die relativ einfache
technische Möglichkeit, dieses giftige Schwermetall herausfiltern
zu können. Eine entsprechende Vorschrift des Gesetzgebers für
alle deutschen Wasserwerke würde deshalb als kleines Konjunkturprogramm
für die Anlagenbauer wirken und gleichzeitig eine Unterbindung
des Uraneintrags durch mineralische Phosphatdünger als weniger
wichtig erscheinen lassen. Die konventionelle Landwirtschaft dürfte
weiterhin mit dem Phosphat auch das Uran aufs Feld verteilen, denn
fürs Entfernen wären ja die Wasserwerke zuständig.
Könnte aber
auch nach hinten los gehen, denn einerseits wäre Uran zwar
nicht mehr im Leitungswasser, dafür aber in ungebremst steigenden
Konzentrationen im Boden und in Pflanzen, die darauf wachsen.
Dann aber müssten wir mit einer Grenzwertbestimmung für
Uran in Lebensmitteln nachrüsten, und hier lässt sich
nicht so einfach filtern.
Und, was geschieht mit den verbrauchten Filtern tausender Wasserwerke,
die ja als Sondermüll gelten?
Wir kommen also nicht um eine Unterbindung jeglichen Neueintrags
von Uran in den Boden herum. Die natürliche und nicht menschengemachte
Uranbelastung des Grundwassers in einigen Regionen ist bei weitem
schon genug des Problems.
05.08.08
Schon seit längerem
wissen Interessierte in unserer Region, dass das Trinkwasser hier
mit Uran belastet ist. Allerlei Vermutungen über die mögliche
Ursache wurden schon entwickelt, aber bisher hat sich noch niemand
bei den für die Trinkwasserversorgung zuständigen Behörden
entsprechend erkundigt und eine Erklärung verlangt.
Jetzt wurde über
einen Bericht
in "Report München" eine Studie der Organisation
"Foodwatch" bekannt,
die genau dieses Problem zum Thema hat. (Die Website von Foodwatch
war gestern abend und heute morgen nicht erreichbar.)
Bei etwa 8000 Proben aus verschiedenen Regionen lagen in 150 Fällen
die Werte des giftigen Schwermetalls Uran über dem zulässigen
Grenzwert von 10 Mikrogramm pro Liter. Über einem Wert von
2 Mikrogramm ist das Wasser für die Zubereitung von Säuglingsnahrung
nicht mehr geeignet. Bei über 800 Proben war dies der Fall.
Der Kieler Toxikologe Hermann Kruse sagte dem Magazin Report: "Schon
sehr geringe Konzentrationen an Uran haben eine schädigende
Wirkung auf lebenswichtige Vorgänge in der Niere",
Dabei gehe die größte Gefahr nicht von der Radioaktivität
aus, sondern von der chemisch-giftigen Wirkung bei anhaltender Einnahme.
Na prima!?!? -
Seit längerer Zeit trinke ich viel Leitungswasser und koche
auch meinen Kaffee damit.
Uran kommt in Spuren meist im Grundwasser vor. Erhöhte Konzentrationen
aber weisen auf einen menschengemachten Eintrag hin. Dies muss noch
nicht mal so etwas mysteriöses wie ein leckes
Waffenlager oder eine Uranabbaustelle sein. Allein die Anwendung
von mineralischem Phosphatdünger in der konventionellen Landwirtschaft
erhöht die Uranwerte im Boden.
Und da sind wir
wieder bei den altbekannten Brunnenvergiftern, den stinknormalen
deutschen Bauern, die zum eigenen Profit und angefeuert von der
Agrarindustrie die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit
schädigen. Und unser Trinkwasser kommt gar aus einer Region
mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, gar nicht weit weg.
Dort, im übernächsten Ort, ist das Grundwasser schon sehr
stark mit Pestiziden und Nitraten belastet. So langsam scheint dies
auf unser Trinkwasserreservoir zuzufließen.
Bleibt noch zu
erwähnen, dass Uran relativ einfach und fast vollständig
aus dem Wasser gefiltert werden kann. Dies sagte jedenfalls Herrmann
Dieter vom Umweltbundesamt dem Magazin Report. Solange aber der
bisherige Richtwert von zehn Mikrogramm nicht zum gesetzlich verbindlichen
Grenzwert erhoben worden ist, warten betroffene Gemeinden häufig
noch ab, weil sie die Kosten scheuen.
Also: Bürger auf die Barrikaden. Fordern wir Uranfilter von
unserem Wasserwerk, damit unser Kaffee wieder besser schmeckt.
(Das Thema ist
auch heute in allen Zeitungen ganz oben).
04.08.08
Aus dem Urlaub
zurück ins "Sommerloch".
Diese nachrichtenarme Zeit, die ja eigentlich ganz angenehm ist,
weil die Selbstdarsteller der Politik noch Ferien machen und uns
ihr überflüssiges Geschwätz erspart bleibt, hat dennoch
etwas unterschwellig bedrohliches.
Einerseits genießt man das Ausbleiben von politischen Entscheidungen
der momentan Regierenden, welche immer seltener ausgegoren und nachvollziehbar
sind, andererseits aber weiß man um die elementare Notwendigkeit
längst überfälliger, richtiger Entscheidungen, weil
die Gegenwart kein statischer Zustand ist, der ein Innehalten erlauben
würde, sondern sie sich eher wie auf einer rutschigen Schräge
befindet, wo es allmählich weiter abwärts geht, wenn das
Gegensteuern ausbleibt.
Offenbar müssen
wir aber noch warten, nicht nur bis nach der Sommerpause, sondern
bestimmt bis nach der nächsten Wahl.
Ob sich dann etwas tut - ja es hängt von so vielem ab, vor
allem von einem inneren Wandel der Parteien, ob sie endlich erkennen,
dass die momentan bestimmende wirtschaftliche Ordnung in die Sackgasse
führt und dass die bisher hochgehaltenen Ideale, wie beispielsweise
das Thema Wirtschaftswachstum mit allen dazu in Verbindung stehenden
Facetten, eigentlich nur Ideologien sind, Klötze am Bein der
Gesellschaft, die ein wirkliches Fortkommen in eine bessere, eine
weniger bedrohliche Zukunft behindern.
Zum Wandel ist
mehr notwendig, als eine neuartige Zusammenarbeit von Parteien,
wie es heute morgen der Journalist Matthias Lohre im
politischen Feuilleton auf Dradio gemeint hat.
Ohne grundsätzliche programmatische Neuorientierung würden
auch neue Parteienkoalitionen unter Beteiligung beider "Scheinzwerge"
Grüne und FDP unsere Gesellschaft nicht von der rutschigen
Schräge heben können.
Urlaub vom 24. Juli
bis 3. August